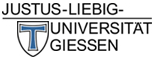Dr. Oliver Schütze
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am IfPh (Theoretische Philosophie)
- Kontakt-Schuetze
-

Rathenaustr. 8, 2. Stock, Raum 203
35394 Giessen
Tel.: + (49)-641-99-15550
Fax: + (49)-641-99-15539
E-Mail: E-Mail-KontaktSekretariat: Hier finden Sie die Kontaktdaten des Instituts-Sekretariats.
Sprechstunde: nach Vereinbarung
- Schwerpunkte
-
Schwerpunkte in Lehre und Forschung
Lehre:
- Logik
- Sprachphilosophie
- Philosophie des Geistes und der Psychologie
- Sozialontologie
aber auch einige Klassiker der Philosophie (Descartes, Kant, Wittgenstein, Sellars).
Forschung:
Bisherige Forschungsschwerpunkte liegen in der Philosophie des Geistes, der Sprachphilosophie und der Theorie der Normativität. Im Vordergrund stehen dabei Fragen nach der Erklärungsreichweite naturalistischer Theorien, ihr Verhältnis zu unserem Selbstverständnis und die Quelle anti-naturalistischer Intuitionen. Diesen Fragen bin ich mit Blick auf mentale Gehalte, sprachliche Bedeutungen und Normativität nachgegangen (insbesondere in (2019): Perspektive und Lebensform).
Aktuelle Forschungsschwerpunkte und Forschungsvorhaben umfassen zudem:
- Theorien der Alltagspsychologie und Sozialkognition
- Soziale und kulturelle Praktiken; kulturelle Evolution
- Selbstbezug, erste Person-Perspektive und das Verhältnis zum Naturalismus
- (Soziale) Mechanismen der Konstitution unseres Selbstverständnisses
- Verstehen und Aspekte des Repräsentierens – Begriffe, Informationen, Schemata, Skripte
- Die Semantik-Pragmatik-Schnittstelle(n); insbesondere die Idee der unartikulierten Komponente
- (Philosophie der) Logik, insbesondere der logische Antiexzeptionalismus
- Bedeutung musikalischer »Äußerungen«
Aktuelles
Akademischer Werdegang
- Akademischer Werdegang
-
- Magister-Studium der Philosophie in Frankfurt am Main von 1999-2006
- Von 2006-2010 Beschäftigungen im Rahmen des SFB »Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel« und später als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Exzellenzcluster »Normative Orders« in Frankfurt am Main
- Seit 2006 Promotionsprojekt zum Thema »Normativität der Sprache«
- Seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theoretische Philosophie an der
Justus-Liebig-Universität Gießen - Januar 2015 Promotion summa cum laude zum Dr. phil. mit der Arbeit: »Perspektive und Form. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Bedeutsamkeit und genuiner Normativität« (Gutachter: Prof. Dr. Matthias Vogel, Prof. Dr. Marcus Willaschek, Prof. Dr. Wolfgang Detel)
Publikationen
- Publikationen
-
Monographien
- Perspektive und Lebensform. Zur Natur von Normativität, Sprache und Geist, Berlin: Suhrkamp 2019.
Aufsätze
-
»About me – on the alleged mysteriousness of the first-person perspective for naturalism«, zusammen mit Gerson Reuter, Zeitschrift für philosophische Forschung, Band 77, 2 (2023).
-
»Warum es keine ›Ich‹-Gedanken gibt (zu Katja Crone: Identität von Personen)«, Zeitschrift für philosophische Literatur, Bd. 7, Nr. 1.
- »Naturalismus und Normativität«, in: A. Becker und W. Detel, Natürlicher Geist. Beiträge zu einer undogmatischen Anthropologie. Berlin 2009, S. 165-188.
Vorträge
- Vorträge
-
-
»Normativity as an evolved form of our practices«, Vortrag im Rahmen des XXV. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Philosophie, an der FAU Nürnberg-Erlangen (09.2021).
-
»Normativity as an evolved form of our practices«, Vortrag auf der Konferenz Norms in a Natural World, an der Philosophischen Fakultät der Universität von Hradec Králové (21.-23.11.2019).
-
»Success Conditions for Normative Talk«, Vortrag auf der Tagung The Future of Normativity an der University of Kent (28.-30.06.2018).
-
»Ich-Äußerungen und selbstbezügliche Gedanken: einige Unterschiede«, Beitrag zum 1. Buchsymposion Frankfurt-Gießen in Gießen über Katja Crones Identität von Personen. Eine Strukturanalyse des biographischen Selbstverständnisses (19.-20.04.2018).
-
»Die Natur von Normativität. Einsichten aus einer Seitenperspektive«, eingeladener Vortrag im Rahmen des Instituts-Kolloquiums der Phillipps Universität Marburg (Januar 2016).
-
»Perspektive und Form: Eine integrative Perspektive auf unser Selbstverständnis als Sprecher und Denker«, eingeladener Vortrag im Rahmen des Philosophischen Kolloquiums der Heinrich Heine Universität Düsseldorf (21.01.2015).
-
»Narrative meaning, aesthetic value and acting freely. Critical remarks on John M. Fischer’s ›Stories and the Meaning of Life‹«, Vortrag anlässlich eines Workshops mit John Martin Fischer an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main (Juni 2009).
-
Lehrveranstaltungen
- Lehrveranstaltungen
-
Gießen
Sommer 2022
- Seminar: Einführung in die Logik
- Seminar: Kulturelle Evolution
Winter 2021-2022
- Seminar: Philosophie der Psychologie
- Seminar: Sprechakttheorien
Sommer 2021
- Seminar: Ruth Millikan: Beyond Concepts (Vorbereitungsseminar auf das Sommerseminar mit Ruth Millikan)
- Seminar: Sprache und Kontext
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Winter 2020-2021
- Seminar: Einführung in die Logik
- Seminar: Einführung in Sprachphilosophie
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Sommer 2020
- Seminar: Einführung in die Logik
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Winter 2019-2020
- Seminar: Was ist Kultur?
- Seminar: Varieties of Social Cognition (in Englisch)
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Sommer 2019
- Seminar: Einführung in die Logik
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Winter 2018-2019
- Seminar: Themen der Sozialontologie: Soziale Gruppen, soziale Praktiken und geteilte Einstellungen
- Seminar: Selbstbewusstsein
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Sommer 2018
- Seminar: Einführung in die Logik
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Winter 2017-2018
- Seminar: Kants Philosophie des Geistes
- Seminar: Alltagspsychologie
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Sommer 2017
- Seminar: Einführung in die Logik
- Seminar: Selbstwissen
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Winter 2016-2017
- Seminar: Sprache und Geist als biologische Kategorien
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Sommer 2016
- Seminar: Theorien direkter Referenz
- Seminar: Pragmatische Aspekte der Sprache
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Winter 2015-2016
- Seminar: Einführung in die Logik
- Seminar: Prädikaten- und Modallogik (gem. mit Matthias Vogel)
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Sommer 2015
- Seminar: Einführung in die Sprachphilosophie
- Seminar: Neuere Arbeiten zur Korrespondenztheorie der Wahrheit (gem. mit Matthias Vogel)
- Seminar: Millikans Theorie höherer kognitiver Fähigkeiten (gem. mit Matthias Vogel)
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Winter 2014-2015
- Seminar: Metarepräsentation
- Seminar: Einführung in die Logik
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Sommer 2014
- Seminar: Logiken philosophischer Argumentation (gem. mit Matthias Vogel)
- Seminar: Ruth G. Millikan: On Clear and Confused Ideas
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Winter 2013-14
- Seminar: Einführung in die Logik
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Sommer 2013
- Seminar: Einführung in die analytische Sprachphilosophie
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Winter 2012-13
- Seminar: Einführung in die Logik
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Sommer 2012
- Seminar: Kindheit des Geistes (gemeinsam mit Norman Hammel)
- Seminar: Ontogenese des Denkens und Bewußtseins (gemeinsam mit Matthias Vogel und Norman Hammel)
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Winter 2011-12
- Seminar: Kant: Kritik der reinen Vernunft (gemeinsam mit Matthias Vogel)
- Seminar: Wilfried Sellars: Im logischen Raum der Gründe
- Seminar: Mentale Repräsentation
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Sommer 2011
- Seminar: Bedeutung und Normativität
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Winter 2010-11
- Seminar: Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen
- Seminar: Descartes: Meditationen
- Seminar: Philosophisches Argumentieren. Logisch-semantische Propädeutik (gemeinsam mit Matthias Vogel)
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Sommer 2010
- Seminar: Wie schreibt man philosophische Texte? Ein Schreibkurs mit dem Schwerpunkt Erkenntnistheorie
- Seminar: Einführung in die analytische Sprachphilosophie
- Kolloquium: Neuere Philosophie des Geistes (gemeinsam mit Matthias Vogel)
Frankfurt
Winter 2007-08
- Seminar: Einführung in die Philosophie des Geistes (zus. mit J. Krebs)
Winter 2004-05
- Tutorium zur Vorlesung Einführung in die theoretische Philosophie (W. Detel)
Winter 2003-04
- Tutorium zur Vorlesung Einführung in die theoretische Philosophie (W. Detel)
Winter 2002-03
- Tutorium zur Vorlesung Einführung in die theoretische Philosophie (W. Detel)