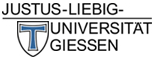Ziele und Versuchsaufbau
Zielsetzung
Das Projekt DeepFarming verfolgt das Ziel:
- die aktuell verfügbare Technik im Bereich präziser Stickstoffdüngung zu erproben
- Die Effizienz des eingesetzten Stickstoffdüngers zu erhöhen
- Die Qualität der Weizenerzeugung zu sichern
- Mögliche Umsetzungshemmnisse zu identifizieren
Versuchsaufbau
An drei Standorten werden vier Varianten der N-Düngung in praxisintegrierten Großparzellen geprüft. Die Parzellenbreite entspricht der Arbeitsbreite bei der Düngung. Die Parzellen werden nach Möglichkeit 3-5 mal wiederholt. Pro Standort werden 2-4 Schläge für den Versuch herangezogen.
Varianten
Variante 1: Deutschlandüblich
Diese Variante soll die in Deutschland übliche, einheitliche Düngung mit drei Gaben darstellen.
Variante 2: Betriebsüblich/XARVIO
Diese Variante soll eine in den Betrieben bereits etablierte Variante des Precision Farming abbilden. Die im 1. Jahr z.T. genutzten Sensoren haben sich nicht bewährt und werden ab dem 2. Jahr einheitlich durch die Variante Xarvio ersetzt.
Variante 3: VISTA/Nnnovative
Diese Variante nutzt das innovative Tool Nnnovative der Firma VISTA, bei der die Applikationskarten auf Basis von Simulationsrechnungen erstellt werden.
Variante 4: VISTA2/VISTA-10%
Bei dieser Variante sollte der Sensor "SoilOptix" zusätzlich zum Einsatz kommen. Dies war aus technischen Gründen jedoch nicht möglich, so dass im ersten Jahr eine weitere Variante VISTA angelegt wurde. Ab dem zweiten Jahr wird bei dieser Variante ein Abschlag von 10 % auf die Düngermenge vorgenommen, um das Niveau der Düngung insgesamt zu prüfen.
Überblick über die genutzten Varianten