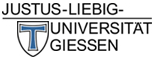Arbeitsgruppe Henrich
Molekulare Tumordiagnostik und adoptive Immuntherapie
Die Forschungsschwerpunkte der Arbeitsgruppe liegen in der molekularen Tumordiagnostik und der adoptiven Immuntherapie. Die molekulare Tumordiagnostik beruht auf Veränderungen auf molekularer Ebene, die neoplastische Zellen im Vergleich mit ihren nicht neoplastisch veränderten Gegenstücken haben. Ziel der molekularen Diagnostik ist es, Verfahren zu entwickeln, um diese molekularen Veränderungen zu erkennen und zur Unterscheidung von neoplastischen zu nicht neoplastischen Zellen einzusetzen. Die adoptive Immuntherapie hat das Ziel, Zellen des Immunsystems mittels gentechnischer Methoden so zu verändern, dass sie gegen krankhafte Prozesse im Körper (vor allem Neoplasien) vorgehen.