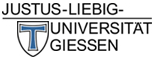Siebert, Diana, Dr.
Diana.Siebert@geschichte.uni-giessen.de | Wissenschaftliche Mitarbeiterin
 |
Dr. Diana SiebertWissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-Projekt: "Territorialisierung in der Belarusischen Sozialistischen Sowjetrepublik Verschiebungen von Grenzverläufen und Maßnahmen zur Flächendurchdringung von 1918 bis 1941" Tel. (Sekretariat): 0049-641-99-28251 |
Forschungsschwerpunkte
- Geschichte der Belarus
- Geschichte von Staatlichkeit und Revolution
- Agrargeschichte
- Geschichte des Geografismus
Projekt: „Territorialisierung in der Belarusischen Sozialistischen Sowjetrepublik Verschiebungen von Grenzverläufen und Maßnahmen zur Flächendurchdringung von 1918 bis 1941“
In der Geschichtswissenschaft bezeichnet Territorialisierung sowohl die herrschaftliche und staatliche Produktion und Durchdringung von Flächen. Unter dieser Prämisse fordern die am Ende des Ersten Weltkrieges vorgenommene Kreierung einer Belarusischen Volksrepublik (BNR) sowie die Konstruktion einer Belarusischen Sozialistischen Sowjetrepublik (BSSR) mit ihren Außen- und Binnengrenzen geradezu zu einer kritischen Analyse heraus. Diese kann empirische Bausteine zu einer Theorie der Territorialität liefern. Denn es ist zu beobachten, wie Moskau in einem 1917 noch umrisslosen Gebiet 1920/21 ein Völkerrechtssubjekt schuf, das in drei Etappen (1924, 1926 und 1939) an Fläche gewann und zu einer ethnisch legitimierten Sowjetrepublik avancierte. Die Etablierung der Sowjetunion mit ihrer am Reißbrett geschaffenen Verwaltungsgliederung verweist im Hinblick auf die Akteure nicht nur auf ethnizistisches, sondern auch auf ein bis dato wenig beachtetes geografistisches Denken ‒ hier bezogen auf eine von ländlichen Räumen geprägte Republik, deren Bevölkerung sich jeglichen Identitäten gegenüber ambivalent verhielt.
Das Projekt will in einer Monographie untersuchen, wie und warum innere und äußere Grenzen der BSSR neu justiert wurden. Wir wollen dabei ausloten, welche Auswirkungen die Entscheidungen der politischen Akteure auf die Titularnation der Belarusen und die Minderheiten der Juden, Polen und Russen hatten. Dadurch wollen wir herausfinden, wie sich das ethnische Paradigma und der Sowjetpatriotismus zu einander verhielten. Während der polnisch-sowjetische Vertrags von 1921 bei der Grenzziehung sprachliche Kriterien noch nicht berücksichtigte, betrieb die Sowjetunion beim Hitler-Stalin-Pakt 1939 auf Grundlage ethnischer Argumente Territorialpolitik. In diesem Sinne fokussiert das Projekt auf den Geografismus der Akteure. Dieser ist als Komplementärideologem zu Kulturalismus und Biologismus anzusehen; er stellt keinen irredentistisch ausbuchstabierten Nationalismus dar, sondern unterliegt der Annahme, Siedlungsgebiete seien Entitäten von langer Dauer. Im Gegensatz dazu versteht das Projekt Territorien als Konstruktion, als etwas von außen wie von innen Gemachtes.