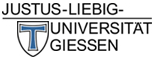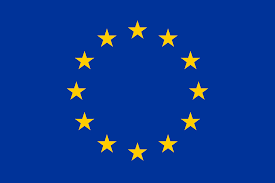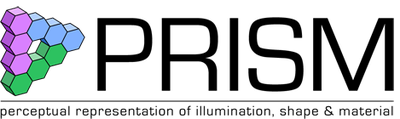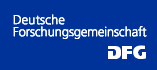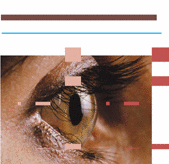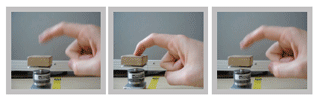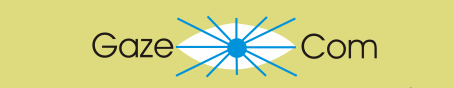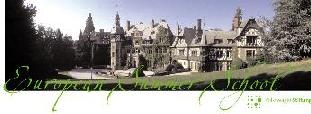Drittmittel
|
ERC Starting Grant, DEEPFUNC, Katharina Dobs Laufzeit 2023-2027 Ziel des Projekts ist es, durch eine Kombination eines Big-Data-Ansatzes mit natürlichem visuellem Input, hypothesen- und datengesteuerten Analysen, jüngsten Fortschritten bei tiefen neuronalen Netzen sowie Verhaltens- und neuronalen Daten die Ursprünge der funktionellen Spezialisierung des visuellen ventralen Pfades im menschlichen Gehirn zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie hier.
|
|
|
ERC Advanced Grant, STUFF, Roland W. Fleming Laufzeit 2023-2027 Um festzustellen, ob ein Gegenstand rau oder glatt, hart oder weich, nass oder trocken ist, müssen wir ihn nicht anfassen - meist reicht ein Blick aus. Ziel dieses Projekts ist es, zu untersuchen, wie das Gehirn aus den Informationen unserer Retina auf solche Objekteigenschaften schließt. Weitere Informationen finden Sie hier.
|
|
|
HMWK, Clusterprojekt The Adaptive Mind Laufzeit 2021-2025 HMWK bewilligt gemeinsames Clusterprojekt „The Adaptive Mind“ (TAM) der Universitäten Gießen und Marburg und TU Darmstadt unter JLU-Federführung. Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst bewilligt das gemeinsames Clusterprojekt „The Adaptive Mind“ (TAM) der Universitäten Gießen und Marburg und TU Darmstadt unter JLU-Federführung, mit Prof. Dr. Karl Gegenfurtner als antragsstellendem Partner für die JLU. In einem interdisziplinären Forschungsteam aus Psychologie, Psychiatrie, Sportwissenschaft, Physik und Informatik soll das Spannungsfeld von Stabilität und Veränderung untersucht werden. Das Kooperationsprojekt wird ab April 2021 in den nächsten vier Jahren mit insgesamt 7,4 Millionen Euro gefördert. Weitere Informationen finden Sie hier.
|
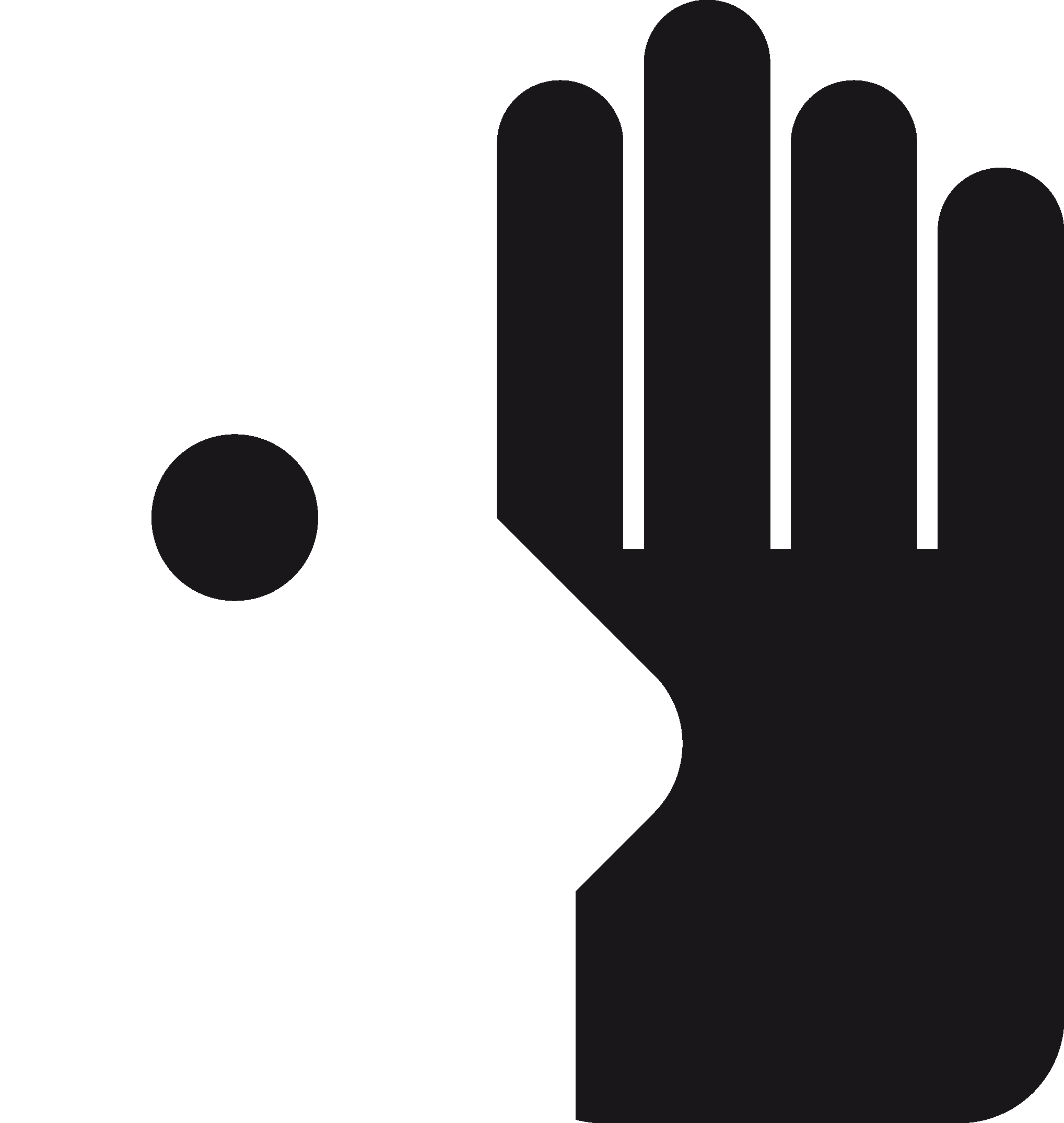 |
|
EU FET OPEN, Chronopilot, Modulation subjektiver Zeit, Knut Drewing Laufzeit 2021-2025 Zeit spielt eine wichtige Rolle im menschlichen Leben. Wenn wir extrem beschäftigt sind oder eine Frist einhalten müssen, rennt die Zeit in unserer subjektiven Wahrnehmung. Das führt zu noch mehr Stress. Umgekehrt kann sich Zeit sehr lang anfühlen, wenn wir uns langweilen- was zu Aufmerksamkeitsverlusten und auf lange Sicht sogar zu Depressionen führen kann. Die richtige Balance von Anforderungen und Input hingegen, ermöglicht es uns unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren und in unserer Tätigkeit aufzugehen. Das EU-finanzierte Projekt ChronoPilot zielt darauf ab, die menschliche Zeitwahrnehmung zu kontrollieren, indem über Technologien erweiterter und virtueller Realität der visuelle, auditorische und haptische Sinn in geeigneter Weise stimuliert werden. Das Projekt bringt Experten führender Institute aus verschiedenen Bereichen wie Psychologie, Informatik und Informationstechnologie zusammen. Weitere Informationen finden Sie hier. |
|
|---|
|
||||
|
||||
|
|
||
|
||
|
||
|
EU FP7 ’People’ Program: Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks 2017 PRISM Netzwerk Das PRISM Netzwerk untersucht, wie das Gehirn Oberflächen unserer alltäglichen Umgebung repräsentiert. Ziel ist es herauszufinden, wie wir Materialeigenschaften, dreidimensionale Formen und Beleuchtung wahrnehmen.
|
|
|
Mesopisches Sehen Das Projekt "Mesopisches Sehen" wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft von November 2010 bis Oktober 2011 mit 200.000 Euro gefördert. Es handelt sich um ein Teilprojekt des Projektes "Neue mesopische bildauflösende Lichtmesstechnik mit Auswertungssoftware und Messkamera" in Kooperation mit der TU Darmstadt (Prof. Khanh) und der Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Prof. Kurtenbach). Die Charakterisierung der visuellen Signalverarbeitung unter mesopischen Beleuchtungsbedingungen ist bislang aufgrund ihrer Komplexität nur unzureichend gelungen. Das Projekt beschäftigt sich mit der mesopischen Bewegungswahrnehmung, da bereits frühere Studien eine systematische Unterschätzung der Eigengeschwindigkeit unter niedrigen Beleuchtungsbedingungen nahe gelegt haben. Mit Blick auf die Relevanz dieser Befunde für den Straßenverkehr soll der Frage nachgegangen werden, welche Auswirkungen unterschiedliche zentrale und periphere Beleuchtungsbedingungen auf die Wahrnehmungen von Eigen- und Objektbewegungen haben. |
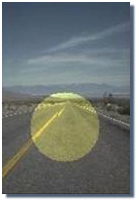 |
|
|
|
European Summer School Laufzeit seit 2004 Die European Summer School konfrontiert junge visuelle Forscher - auf spätem prä-doctoralen oder frühem post-doctoralen Level - mit den prinzipiellen Methoden und grundlegenden Themen zeitgenössischer visueller Neurowissenschaften. Zusätzlich strebt sie den Aufbau einer grundlegenden Sprachkompetenz in der neu entstehenden Wissenschaftssprache der berechnenden Neurowissenschaften an. Die Spannweite an Themen ist breit, buchstäblich von den "spikes to awareness", und der Fortschritt dementsprechend rasch. Diese intensive Erfahrung sollte es den Teilnehmern ermöglichen, eine breitere Sicht zu haben auf und besser informierte Entscheidungen zu machen über ihre zukünftige Forschungsrichtung. Bei der European Summer School wird von führenden Forschern aus Neurobiologie, Neuropsychologie, Psychophysik und theoretischen Neurowissenschaften gelehrt. Zwei thematisch verwandte Themengebiete werden täglich behandelt, wobei jedes dieser in etwa 3 Stunden Zeit behandelt wird (inklusive Diskussionszeit). Eine after-dinner Diskussion bietet eine Möglichkeit die tägliche Lehre zu kontrastieren und zu vergleichen. Des Weiteren verwirklichen die Teilnehmer nachmittags rechenbetonte und theoretische Projekte (basierend auf Matlab), um mit den Schlüsselkonzepten und Techniken der berechnenden Neurowissenschaften zu experimentieren. |
|
|---|
|
DFG Projekt - Cortical mechanisms of color vision Das DFG Projekt Cortical mechanisms of color vision (2001-2009): Ziel der hier vorgestellten Arbeiten ist die Erforschung der kortikalen Verarbeitung von Farbinformation. Zum einen soll geklärt werden welche farbspezifischen Mechanismen die aus der Retina kommenden Signale weiterverarbeiten, um zu einer präzisen und stabilen Repräsentation von Farbe im visuellen Kortex zu gelangen. Es wird untersucht inwieweit diese Information dann für andere Wahrnehmungsaufgaben, wie der Berechnung von Form und Bewegung, zur Verfügung gestellt wird. Farbe soll also nicht losgelöst von anderen Bildmerkmalen betrachtet werden. Vielmehr soll geklärt werden wie diese Merkmale integriert werden um zu einer einheitlichen Repräsentation unserer natürlichen Umwelt zu gelangen. |
|||
|
DFG Projekt - Perception of natural scenes DFG Projekt "Perception of natural scenes" (2002-2006): Ziel der hier vorgestellten Arbeiten ist die Erforschung der visuellen Verarbeitung von Bildern natürlicher Szenen. Fast alles, was wir über die Informationsverarbeitung visueller Reize im menschlichen Gehirn wissen, entspringt psychophysischen und neurophysiologischen Forschungsarbeiten, die nur sehr einfache Stimuli verwendet haben, wie z.B. Sinusgitter, Lichtpunkte, oder Liniensegmente. Doch in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass oftmals selbst unter diesen reduzierten Stimulusbedingungen nicht-lineare Verarbeitungsmechanismen das Verhalten des Sehsystems im Ganzen dominieren. Folglich gilt es primär zu klären, inwieweit das Wissen um die, in Näherung linearen, frühen Stufen visueller Verarbeitung bei der Erklärung komplexer visueller Sehleistungen, wie z.B. der Wahrnehmung natürlicher Bilder, von Nutzen ist. Konkret werden wir versuchen, durch eine Reihe experimenteller Variationen einer Kategorisierungsaufgabe in Tier/Nicht-Tier Bilder, herauszufinden, welche Bildmerkmale vom menschlichen Sehsystem zur Lösung dieser Aufgabe herangezogen werden. Diese werden dann verglichen mit den Bildmerkmalen, die rein statistisch optimal zur Lösung der Aufgabe geeignet sind. |
|||
|
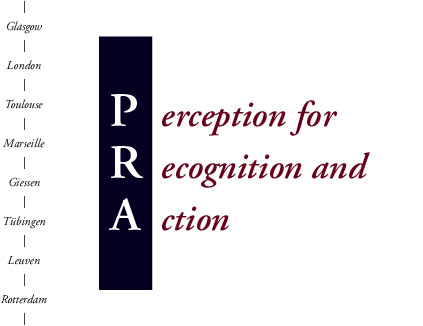 |
|
ModKog ModKog wurde vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung von 2002 bis 2005 finanziert. Das Projekt basiert auf interdisziplinärer Forschung im Feld der visuellen Aufmerksamkeit und stellt sich Anwendungen im Bereich der medizinischen Diagnostik und visuellen Kommunikation vor. Innerhalb ModKogs kollaborieren wir eng mit dem Institut für Neuro- und Bioinformatik der Universität Lübeck und SensoMotorik Instruments in Teltow/Berlin. Unsere Ziele mit ModKog werden unter Itap zusammengefasst. |
|
|---|