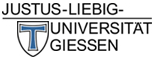Professur Mediensoziologie
Die Gießener Professur für Soziologie im Schwerpunkt Mediensoziologie beschäftigt sich mit dem Wechselspiel von Medien und Gesellschaft. Im Fokus von Forschung und Lehre stehen insbesondere die sozialen Implikationen neuer Technologien. Die an der Professur angesiedelte Forschung widmet sich dabei aktuell unterschiedlichen Gegenständen wie jenen der digitalen Selbstvermessung, der statusspezifischen Internetverwendung oder der Nutzung gesundheitsbezogener Internetforen.
Im Rahmen der derzeitigen Vertretung (apl. Prof. Dr. York Kautt) stehen Fragestellungen zur Transformation von Gesellschaft in unterschiedlichen Bereichen im Mittelpunkt (Esskultur, Nachhaltigkeit, Reallabore, Image-Kommunikation u.a.).