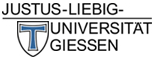Workshop Hustedt
Ergebnisse des Workshops „Geschichtsunterricht sprachbewusst planen“ von Stefanie Hustedt (Gießen)
Bei einem ersten Erfahrungsaustausch in der Runde wurde schnell deutlich, dass Probleme im Geschichtsunterricht mit stark heterogenen Klassen und sprachschwachen Schülern nicht erst auf der Ebene des Sprachverstehens/ der Sinnentnahme aus Texten entstehen:
Aus Sicht der Kollegen manifestiert sich das Problem des Zugangs zu historischen Themen und der Lernwürdigkeit aus Schülersicht auf motivationaler und volitionaler Ebene und stellt sich so noch „vor“ die sprachliche Auseinandersetzung mit einem Sachtext.
Bereits an dieser Stelle des Workshops wurde also deutlich, dass didaktische Prinzipien und die didaktische Reduktion als Ganze eine mindestens ebenso hohe Relevanz haben wie die Analyse sprachlich-begrifflicher Herausforderungen. Im Einzelnen werden folgende Strategien der Kollegen genannt:
Etwa der Fokus auf Akteure der Geschichte (Personalisierung/Personifizierung) und damit verbunden: imaginative Zugänge zu Geschichte (etwa über „Zeitreisen“, visuelle Darstellungen bzw. Bildquellen oder Geschichtserzählungen).
Als ebenfalls essentiell für die verstehende Auseinandersetzung mit Geschichte wird eine gute Orientierung der Schüler – vor allem in Form einer erkenntnisleidenden Frage für den Unterrichtsverlauf benannt. Dies schließt andererseits nicht aus, dass im Interesse einer hohen Schülerorientierung auch mit offeneren Lernformen – wie dem eigenständig-forschenden Lernen, etwa unter Nutzung einer Bücherkiste – gute Erfahrungen gemacht wurden.
Speziell im Hinblick auf den sprachbewussten Unterricht/ den Umgang mit Texten wurden unterschiedliche Erfahrungen und Bedürfnisse laut:
Z.T. arbeiten die Kollegen völlig ohne Lehrbuchtexte. Zum einen weil deren Passung aus verschiedenen Gründen (hohe Dichte, schwierig herzustellende Kohärenzen, unklare Begriffe etc.) nicht gegeben scheint. In einem Fall wurde berichtet, dass sämtliche Texte durch die Lehrperson selbst verfasst werden. Im Bereich des Förderschullehramts werden Texte schon länger expandiert bzw. ihre Informationsdichte gemindert.
Zum anderen wird mehrfach die Erfahrung bestätigt, dass ergänzendes bzw. binnendifferenzierendes Material der Verlage ebenfalls nicht den Bedürfnissen der Schüler und Lehrer gerecht wird: hier aber insofern, als das Anforderungsniveau zu gering/ im AFB I zu verorten ist.
Andererseits besteht im Sinne einer effektiven Unterrichtsvorbereitung auch der Wunsch, mit den vorhandenen Lehrbuchtexten umzugehen.
Gemeinsam werden schließlich in der Workshoparbeit Möglichkeiten besprochen, eine vorher analysierte Lehrbuchseite 1, die viele sprachliche Herausforderungen enthält, so einzusetzen, dass auch sprachschwächere Schüler profitieren können:
Hierfür wurden konkret benannt: eine Problemfindungsphase mithilfe der Karikatur „Man muss hoffen, dass das Spiel bald vorbei ist“ mit anschließender Hypothesenbildung (= Formulierungvon Erwartungen an den Text). Eine veränderte Reihenfolge der Abschnitte des Darstellungstextes auf S. 12 (Abschnitt 3,1,2) Visualisierungshilfen für die Darstellung der Ständegesellschaft, Klärung von Begriffen im Plenum und ggf. Annotation auf einer Kopie, Beschriftung der Karikatur mit den einzelnen Ständen sowie deren Rechten und Pflichten.
1 Bühler, Arnold u.a. (Hg.), Geschichte entdecken 3, Ausgabe Hessen, Bamberg (C.C:Buchner), 2013, S. 12