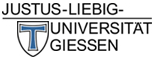Workshop Rox-Helmer Literaturliste
Ergebnisse des Fachtags Geschichte am 14.11.2017 mit dem Titel „Geschichte als Lesefach?!“
Auf den vergangenen Fachtagen wurden von TeilnehmerInnen immer wieder Schwierigkeiten beim Lesen der Texte, die Grundlage des Geschichtsunterrichts sind, angesprochen. Der Fachtag 2017 thematisierte deshalb die Fachspezifik des Textverstehens im Geschichtsunterricht sowie die Herausforderungen beim Lesen und Bearbeiten von Quellen- und Darstellungstexten.
Frau Prof. Dr. Saskia Handro (Münster) führte in einem Vortrag mit dem Titel ‚Geschichte als Lesefach – geschichtsdidaktische Perspektiven auf fachspezifische Leseprozesse‘ in die theoretischen Aspekte des Themas ein und stellte erste Ergebnisse einer empirische Untersuchung vor.
Sie stellte grundlegend heraus, dass das Lesen im Fach Geschichte mehr erfordere als die allgemeine Lesekompetenz, zu der die PISA-Ergebnissen aufgedeckt haben, dass bei vielen Schülerinnen und Schülern bereits diese nicht ausreichend ausgebildet sei. Das bildungspolitische Programm ‚Lesen in allen Fächern’ sei ein Ansatz auf die Bedürfnisse der Fächer zu reagieren, Leseförderung im Fach dürfe allerdings nicht nur als Additum betrachten. Es müsse insbesondere darum gehen, die jeweilige Fachspezifik herauszuarbeiten.
Für das Fach Geschichte – erläuterte Handro – äußere sich eine Spezifik zum einen darin, dass mit den Quellen eine Textgattung im Geschichtsunterricht gelesen werden müsse, die in anderen Fächern keine Rolle spiele. Diese Texte seien zumeist sehr komplex und erforderten spezifische Fähigkeiten im Umgang. Da Quellentexte nicht den Lesefähigkeiten der Schülerinnen und Schüler angepasst werden können, müsse es darum gehen, das selbstständige Lesen dieser Texte in besonderer Weise anzuleiten und einzuüben. Die Referentin stellte zudem anhand von Befunden zum Schulbuchverständnis dar, dass auch das Lesen von Darstellungstexten im Fach Geschichte nicht unproblematisch sei, weil es sich um hochverdichtete Text handelt. Es müsse folglich darum gehen, fachspezifische Lernwerkzeuge zur Verfügung zu stellen. Dafür müsse die Didaktik allerdings zunächst klären, wie Lernende Texte verstehen.
Aus diesem Grund sind von der Professur Didaktik der Geschichte an der Uni Münster Praxisstudien mit Schülern am Beispiel verschiedener Schulbuchtexte durchgeführt worden. Untersucht wurden die Arbeitsaufträge zur Erschließung historischer Sachverhalte, die Hinweise zur Bearbeitung verschiedener Textgattungen sowie der Einbezug von Grafiken und anderen Visualisierungshilfen. Ergebnisse dieser Untersuchungen präsentierte und erläuterte Handro. Dabei markierte sie folgende Aspekte als besonders relevant für die Planung und Durchführung von Textarbeit im Geschichtsunterricht:
- Auf der Ebene der Lexik können Wortschatzprobleme noch relativ leicht erkannt und behoben werden; schwieriger sind die Probleme auf der Satzebene, wo Kohärenzen und Bezüge sowie Textmuster erkannt werden müssen. Im Fach Geschichte müssen vor allem Zeitmarker als organisierendes System genutzt werden können.
- Bei der Einschätzung des Schwierigkeitsgrades eines Textes müssen der Abstraktionsgrad, die Informationsdichte, Leserführung und Inhaltsorganisation mitbedacht werden. Ebenso muss die Frage einbezogen werden, inwieweit Anschlüsse an die Lebenswelt oder das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler möglich sind.
- Die Lesemotivation und -bereitschaft für fachliche Texte ist entscheidend für die Ausprägung eines Selbstwirksamkeitsbildes und die Haltung zum Lesen im Fach. Diese trägt in bedeutendem Umfang zum Textverstehen bei.
- Quellentexte müssen in ihrer Alterität thematisiert werden und bei Darstellungstexten müssen der Standortbezug, die Perspektivität und der Konstruktcharakter reflektiert werden, denn diese sind in der Regel nicht offen kenntlich.
- Problematisch ist im Fach Geschichte oft, dass Alltagssprache als Fachsprache verwendet wird und damit Wortschatzprobleme nicht erkannt werden.
Einen fachunspezifischen Hilfsansatz stellt das sogenannte Scaffolding dar. Darunter wird das Bereitstellen von Hilfestellungen in lesetechnischer wie hermeneutischer Art sowie durch semantische Vorstrukturierungen verstanden.
Handro plädiert jedoch auf der Grundlage ihrer empirischen Untersuchungen dafür, Leseförderung fachspezifisch auszurichten. Dabei sollte sich die Leseförderung im Fach an den historischen Basiskonzepten orientieren. Das bedeutet, eine historische Frage muss die Erschließung unterschiedlicher Informationsschichten sowie die Gewichtung der Informationen und den Begriffsaufbau leiten. Sie belegt diese These durch die Beobachtungen beim Schülerwettbewerb, die beweisen, dass Schüler durchaus in der Lage sind, forschende Arbeitsweisen mit dem Erwerb von Lesestrategien für Quellen und Darstellungen zu verbinden. Lesestrategien gehören zu den Lernstrategien im Fach und müssen als historische Lernwerkzeuge im Geschichtsunterricht vermittelt werden.
Am Nachmittag fand eine Vertiefung des Themas in Form dreier Workshops statt.
Dr. Peter Adamski (Kassel), ‚Historische Lesekompetenz diagnostizieren‘
Wir stellen Ihnen mit Erlaubnis des Verfassers hier die Powerpoint-Präsentation seines Workshops zur Verfügung:
Stefanie Hustedt (Gießen) ‚Historische Lesekompetenzen
diagnostizieren‘
Link zu Bericht Hustedt
Workshop „Geschichtsunterricht sprachbewusst planen“
Bei einem ersten Erfahrungsaustausch in der Runde wurde schnell deutlich, dass Probleme im Geschichtsunterricht mit stark heterogenen Klassen und sprachschwachen Schülern nicht erst auf der Ebene des Sprachverstehens/ der Sinnentnahme aus Texten entstehen:
Aus Sicht der Kollegen manifestiert sich das Problem des Zugangs zu historischen Themen und der Lernwürdigkeit aus Schülersicht auf motivationaler und volitionaler Ebene und stellt sich so noch „vor“ die sprachliche Auseinandersetzung mit einem Sachtext.
Bereits an dieser Stelle des Workshops wurde also deutlich, dass didaktische Prinzipien und die didaktische Reduktion als Ganze eine mindestens ebenso hohe Relevanz haben wie die Analyse sprachlich-begrifflicher Herausforderungen. Im Einzelnen werden folgende Strategien der Kollegen genannt:
Etwa der Fokus auf Akteure der Geschichte (Personalisierung/Personifizierung) und damit verbunden: imaginative Zugänge zu Geschichte (etwa über „Zeitreisen“, visuelle Darstellungen bzw. Bildquellen oder Geschichtserzählungen).
Als ebenfalls essentiell für die verstehende Auseinandersetzung mit Geschichte wird eine gute Orientierung der Schüler – vor allem in Form einer erkenntnisleidenden Frage für den Unterrichtsverlauf benannt. Dies schließt andererseits nicht aus, dass im Interesse einer hohen Schülerorientierung auch mit offeneren Lernformen – wie dem eigenständig-forschenden Lernen, etwa unter Nutzung einer Bücherkiste – gute Erfahrungen gemacht wurden.
Speziell im Hinblick auf den sprachbewussten Unterricht/ den Umgang mit Texten wurden unterschiedliche Erfahrungen und Bedürfnisse laut:
Z.T. arbeiten die Kollegen völlig ohne Lehrbuchtexte. Zum einen weil deren Passung aus verschiedenen Gründen (hohe Dichte, schwierig herzustellende Kohärenzen, unklare Begriffe etc.) nicht gegeben scheint. In einem Fall wurde berichtet, dass sämtliche Texte durch die Lehrperson selbst verfasst werden. Im Bereich des Förderschullehramts werden Texte schon länger expandiert bzw. ihre Informationsdichte gemindert.
Zum anderen wird mehrfach die Erfahrung bestätigt, dass ergänzendes bzw. binnendifferenzierendes Material der Verlage ebenfalls nicht den Bedürfnissen der Schüler und Lehrer gerecht wird: hier aber insofern, als das Anforderungsniveau zu gering/ im AFB I zu verorten ist.
Andererseits besteht im Sinne einer effektiven Unterrichtsvorbereitung auch der Wunsch, mit den vorhandenen Lehrbuchtexten umzugehen.
Gemeinsam werden schließlich in der Workshoparbeit Möglichkeiten besprochen, eine vorher analysierte Lehrbuchseite[1], die viele sprachliche Herausforderungen enthält, so einzusetzen, dass auch sprachschwächere Schüler profitieren können:
Hierfür wurden konkret benannt: eine Problemfindungsphase mithilfe der Karikatur „Man muss hoffen, dass das Spiel bald vorbei ist“ mit anschließender Hypothesenbildung (= Formulierungvon Erwartungen an den Text). Eine veränderte Reihenfolge der Abschnitte des Darstellungstextes auf S. 12 (Abschnitt 3,1,2) Visualisierungshilfen für die Darstellung der Ständegesellschaft, Klärung von Begriffen im Plenum und ggf. Annotation auf einer Kopie, Beschriftung der Karikatur mit den einzelnen Ständen sowie deren Rechten und Pflichten.
Workshop:
Monika Rox-Helmer (Gießen) ‚Lesemethoden für den Geschichtsunterricht‘.
Der Workshop "Lesemethoden im Geschichtsunterricht" ging der Frage nach fachspezifischen Lesestrategien nach. Dafür wurde die Methode des Lauten Denkens (Ruth Schoenbach u.a.) genutzt, um das Vorgehen von 'Profi-Geschichtslesern' zu reflektieren. Die identifizierten Lesestrategien wurden den Kompetenzbereichen zugeordnet, die das Lernprozessmodell von Gautschi, auf dem auch die hessischen Bildungsstandards fußen. Auf diesem Weg ist eine erste Sammlung entstanden, wie auf den unterschiedlichen Ebenen des historischen Lernprozesses das Lesen in die Kompetenzförderung einbezogen werden kann/muss.
Eine Anleitung für die Methode des Lauten Denkens, die auch als Lesemethode im Unterricht eingeführt werden kann, finden Sie zusammen mit den Workshopergebnissen hier zum Download:
Und dann einen entsprechenden Link zum pdf.
Inhalt des Links:
Weiterführende Literatur zum Thema finden Sie hier....
Und dann einen entsprechenden Link zur Literaturliste.
[1]Bühler, Arnold u.a. (Hg.), Geschichte entdecken 3, Ausgabe Hessen, Bamberg (C.C:Buchner), 2013, S. 12
Verantwortlich für die Zusammenfassung:
Andreas Willershausen